Filme des Jahres 1968
Version von Christian_alternakid :: 19.11.2021

1. 2001: Odyssee im Weltraum
Ein Jahr vor der Mondlandung inszenierte Stanley Kubrick den akkuratesten Weltraum-Film überhaupt - und war so überzeugend, dass sich die Verschwörungstheorie lange hielt, er habe auch die Mondlandung im Auftrag der NASA in einem Studio aufgenommen.
Was natürlich Quatsch ist, denn die Wirklichkeit sah auch nie annähernd so gut aus, wie Kubrickss Meisterwerk des Retrofuturismus.
Perfekte Sets kommen in "2001" mit einer nahezu undurchdringlichen, auf einer Kurzgeschichte von Arthur C. Clarke beruhenden Erzählung zusammen. Die erste halbe Stunde ist stumm und beginnt vor der Menschheit, das Ende ist ein Fiebertraum in allen Farben der Welt und eine wortlose Wiedergeburt des Lebens.
"2001" kam wahrscheinlich auch genau zur richtigen Zeit ins Kino: der Moment, in dem die Forschrittsgläubigkeit und der Weltblick der Stoner & LSD-Jünger gleichzeitig vorhanden war. Dass das Establishment Kubrick bei der Oscar-Verleihung mit Ausnahme des Special-Effects-Oscars überging: geschenkt, über euch lacht heute die Welt.
(Übrigens: der Special-Effects-Oscar sollte sogar der einzige Academy Award bleiben, den Kubrick je erhalten würde. Was angesichts dessen größter Filmographie der Geschichte eigentlich zur sofortigen Auflösung der Academy führen sollte)
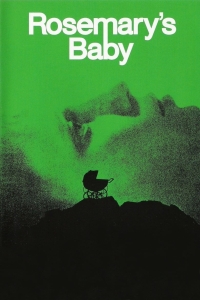
2. Rosemary's Baby
Der beste Horrorfilm von allen. Polanskis großer Kniff ist sein Wille zur Ambiguität. Im Grunde bleibt bis zur Schlußszene unklar, ob wir hier Mia Farrows Charakter in der Phase einer tiefen Depression sehen oder ob dieses Haus, seine Nachbarn, ja vielleicht sogar ihr Mann?, mit dem Teufel selbst im Bunde sind. Das Haus, in dem Rosemary wohnt, ist ein weiterer Hauptdarsteller und wird von Polanski eingefangen wie eine bedrohliche Gothic-Kirche.
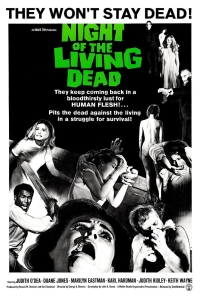
3. Night Of The Living Dead
"Die Nacht der lebenden Toten" war anders.
George A Romeros erster Zombie-Film ist in sich politisch, the "first-ever subversive horror movie" (Village Voice), eine Allegorie auf den Krieg in Vietnam, den Romero insbesondere in seinen visuellen Mitteln spiegelt, und noch mehr als Statement über Weiße gegen Schwarze in Amerika selbst.
Die heroischste Figur in dieser Nacht der lebenden Toten ist der Afroamerikaner Ben, der mit größter Vehemenz und schärfster Intelligenz gegen die drohende Gefahr von Außen kämpft und der Gruppe mehrfach das Leben rettet. Umso tragischer ist das Ende, das wieder den Kreis schließt zur Vietnam-Allegorie: während man gern die Schwarzen als Soldaten in einen Krieg schickte, um die "gemeinsame Heimat" zu verteidigen, behandelte man sie dort mit der gleichen Missachtung wie zuvor.
Vielleicht der wichtigste Horrorfilm überhaupt.
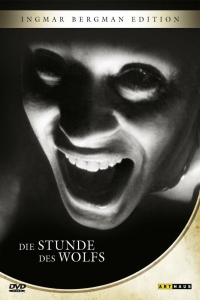
4. Die Stunde des Wolfs
Einer der rätselhaftesten Filme Ingmar Bergmans und einer der erschütterndsten. Näher war Bergman nie am surrealen Horrorfilm, aber "Die Stunde des Wolfs" ist mehr ein inneres Psychogramm, eine Collage von Albträumen und damit dem ursprünglichen Wesen des Horror wahrscheinlich näher als jeder Schlitzer-Film.

5. Spiel mir das Lied vom Tod
Während ich mit Sergio Leones ebenfalls legendäre "Handvoll Dollar"-Trilogie nie wirklich warm geworden bin, erreicht "Spiel mir das Lied vom Tod" auch meine Welt. In meiner Jugend war ich irre fasziniert von der Regungslosigkeit der langen Eröffnungssequenz, die im Grunde die Stärken des dreistündigen Leones Film schon gut zu Beginn zusammenfasst.
Die verschachtelte (und verwirrende) Geschichte um Eisenbahnbau und Menschengier ist wie in Polanskis "Chinatown" zwar einerseits plottreibend, aber andererseits in ihren Details auch fast egal, weil die daraus entstehende Atmosphäre des Jeder gegen Jedens die eigentliche Spitze der Inszenierung ist.
"Once Upon A Time In The West" ist ohne Frage der große Italo-Western, aber ich würde soweit gehen, dass zumindest für alle Nachtweltkriegsgenerationen Leone hier sogar den epischen Western überhaupt gedreht hat und mit seinem Meisterwerk alle amerikanischen Vorbilder übertrifft.

6. Zur Sache, Schätzchen
"Kennst du Werner Enke?" fragte die Liga der gewöhnlichen Gentlemen 2015 und die traurige Antwort der meisten darauf war: "Nee...".
Dabei ist dank Werner Enkes Drehbuch und Mary Spils Regie (ein Name, der NOCH mehr in Vergessenheit geraten ist!) "Zur Sache Schätzchen" einer der besten deutschen Filme der 60er Jahre. Ein frecher, wilder, aber immer spielerischer Aufschrei gegen das Establishment. Natürlich hatte Spils die Nouvelle Vague - Filme gesehen, aber in Zusammenarbeit mit Enke gelang ihr hier etwas völlig anderes, freieres, weniger verkopftes als den französischen Kollegen. Es ist wirklich eines der großen Rätsel des deutschen Films, warum dieses Erbe so in Vergessenheit geraten ist.

7. Bullitt
Steve McQueen auf dem Höhepunkt seiner Karriere.
Passend natürlich, dass der bekennende Autonarr (siehe auch seinen später selbst produzierten "Le Mans"-Film) in "Bullitt" die Autoverfolgungsjagd schlechthin drehen konnte, die gleich zu Filmbeginn für volle 11 Minuten durch San Francisco rast. Aber auch zu Fuß machen McQueen und "Bullitt" eine gute Figur. Die zeitgenössische Kritik der New York Times fand das schöne Fazit, dass das Ende des Films "Fans von "Polizeibericht" bis Camus zufriedenstellen sollte".

8. Targets
Peter Bogdanovichs Debütfilm ist ein Wunder der Effizienz: Produzent Roger Corman gab Bogdanovich ein kleines Budget unter der Vorgabe, den Altstar Boris Karloff mit der Hauptolle zu betrauen und 20 Minuten Material aus seinem Schlock-Film "The Terror" zu verwenden. Was in anderen Händen in einem mehr schlecht als recht zusammengeflickten Frankenstein von einem Film geendet hätte, wurde unter Bogdanovichs Regie (der auch mit seiner Partnerin Polly Platt das Drehbuch geschrieben hat) zu einem der zündenden Feuerwerke für New Hollywood, sozusagen der "Bonnie & Clyde" von unten.
Bogdanovich ersinnt zwei zunächst scheinbar unabhängige Storylines, gibt in der einen Karloff eine Meta-Rolle als alternder Filmstar, der nicht mehr in Schlock-Filmen gegen Monster kämpfen möchte, und führt in der anderen einen squaky-cleanen Mittelklassetypen ein, der sich als Psychopath erweist und ohne Grund außer "funny thoughts" einen Amoklauf startet. Am Ende wird Karloff einem neuen Monster gestellt: dem der Realität, des Mörders aus der Mitte der Gesellschaft. Das ist gleich auf mehreren Ebenen so dermaßen modern inszeniert, an der neuen Welle europäischer Filme geschult und eine solche Abkehr vom althergebrachten amerikanischen Kino, dass der ewige Ruf dieses 130.000 Dollar Low Budget Films auch heute noch verdient ist.

9. Lebenszeichen
Die vielen skurrilen Geschichten über Werner Herzog und seine Interviews, die eine Art Kunstfigur transportieren, lassen oft vergessen, welch widerspenstige und doch zugleich hochemotionale Filme Werner Herzog gedreht hat.
Ein schönes Beispiel ist die Schlußsequenz von „Lebenszeichen“, Werner Herzogs Debütfilm von 1968:
„In der zweiten Nacht, als sich Stroszek zum zweiten Mal mit einem Feuerwerk herrlichte, wurde er von seinen eigenen Leuten überwältigt. (…) Er hatte in seinem Aufbegehren gegen alles etwas Titanisches begonnen, denn der Gegner war hoffnungslos stärker. Und so war er so elend und so schäbig gescheitert wie alle seinesgleichen.“

10. If....
Bevor Malcolm McDowell mit Alex in "Clockwork Orange" einen der prägendsten Charaktere für Gegenkultur überhaupt verkörperte, spielte er einen Schulrebellen in "If...".
Lindsay Andersons Cannes-Gewinner hat vor allem auf der Insel einen geradezu mythischen Ruf: Im Ranking des British Film Institutes landete "If..." auf #12 der besten britschen Filme aller Zeiten, obwohl die Satire über die unerträglichen Zustände an englischen Schulen insbesondere wegen seines aufbegehrenden Endes zur Veröffentlichung heiß umstritten war und nur mit einem "X"-Rating in die Kinos kommen durfte.

11. The Thomas Crown Affair
Eine (New-)Hollywood-Extravaganza der Sonderklasse mit einem Steve McQueen in bestem "sexiest man alive"-Modus.
McQueen legt seinen Mastermind-Gauner-aus-Langeweile mit so viel stylisher Klasse an, dass ich mir hier erstmals einen amerikanischen James Bond vorstellen konnte. Dass der Plot nach der ersten Aufdeckung mit folgender Annäherung durch die Meisterdieb-Jägerin Faye Dunaway ein wenig dahindröppelt und mich auch gegen Ende nicht so wirklich überzeugt, ist geschenkt, denn selten wurden Split-Screens schöner eingesetzt und dabei bessere Klamotten getragen.

12. Bei Bullen singen Freunde nicht
Auf "Adieu L'Ami"* bin ich über den tollen B-Movie-Podcast** des New Beverly Cinemas mit Quentin Tarantino gestoßen. Bevor Charles Bronson in seinem Heimatland mit "Death Wish" & Co. zum Star wurde, war er in Europa dank des 1968er Doppelschlags aus "Spiel mir das Lied vom Tod" und "Adieu L'Ami" bereits eine große Nummer. Obwohl "Adieu L'Ami" einer der großen Hits des Jahres in Frankreich war, wurde "Farewell, Friend" (so der englische Titel) in den USA erst fünf Jahre später veröffentlicht.
Im gelungen gegensätzlichen Casting aus Bronson und Alain Delon liegt die Kraft des Films, die beide entlang ihrer bekannten Charakterzüge spielen und so ein schönes Ganoven-Gegensatzpaar aus ruchlos & eiskalt abgeben. Plot und Inszenierung wirken immer ein wenig neben der Spur, dass ich manchmal nicht so recht wusste, wohin dieser Heist-Film eigentlich will, was aber auch seinen Reiz ausmacht. Bestes Beispiel dafür ist eine fantastische, eigentlich völlig nutzlose, längere Sequenz in der ersten halben Stunde, die in einer abstrakt künstlerischen Art Bronsons Zwischenjob als Zuhälter zeigt und irgendwo zwischen Bunuels "Belle De Jour" und Refns "Neon Demon" liegt, ohne dabei die Assigkeit des Bronson-Charakters zu minimieren.
Auch dass die Auflösung der ganzen Chose zwei anderen Charakteren das Heft des Handelns in die Hand gibt, ist eine schöne Überraschung.
"Adieu L'Ami" mag nicht ohne Längen und Plotlöcher sein, hebt sich aber gerade dadurch von klassischem Eurocrime-Genre-Stoff dieser Zeit ab und wird so zu etwas eigenem.
* einer für die Ahnengalerie der deutschen Kinoverleihtitel: egal ob vom Original mit "Adieu L'Ami" oder dem englischsprachigen Titel "Farewell, Friend", der Weg zur deutschen Version mit "Bei Bullen 'singen' Freunde nicht" ist schon ein sehr weiter, umständlicher.

13. Ich bin neugierig (blau)
"I Am Curious (Blue)" ist aus dem gleichen Holz geschnitzt wie sein Schwester-Film "I Am Curious (Yellow)": ein Hybrid aus soziopolitischer Doku und individualsexueller Fiktion, wobei das blaue Pendel stärker in RIchtung Politik ausschlägt, den Sexpart deutlich zurückfährt und dahingehend, abgesehen von eventuell damaligen Befindlichkeiten hinsichtlich des Zeigens von lesbischem Sex und Redens über Masturbation, eigentlich kaum Skandalerregungspotenzial bietet.
Die politischen Positionen dagegen sind sicher auch aus heutiger Sicht noch umstritten im Mainstream: gegen die Staatskirche, gegen die Klassengesellschaft, gegen die Lohnarbeit, gegen die Idee Gefängnis und über allem gegen das Prinzip Verdienst für Verdienst, also gegen jede Meritokratie. "I Am Curious" denkt den schwedischen Wohlfahrtsstaat komplett zu Ende, hinterfragt aber natürlich - wie eigentlich immer bei Filmen mit dieser Position - leider keine alternative Finanzierung der Welt. Zwar verdient laut Film der Architekt das Zweieinhalbfache der Kaltmamsell (ein Beruf den ich LANGE nicht mehr gehört habe!), zahlt aber auch bereits 80% Steuern. Deshalb ist es fast kurios, dass ausgerechnet ein schwedischer Film diese Forderungen mit solcher Dringlichkeit aufstellt und in der Folge in den USA zu einem solchen Counter-Culture-Sensationserfolg wurde, wäre doch für die amerikanische Gesellschaft schon der hier von Vilgot Sjöman so arg kritisierte Ist-Zustand Schwedens ein "marxistisches Paradies".
Filmisch hat "Blue" Stärken in seiner verschränkten, sich selbst hinterfragenden Struktur und der Thematisierung des Prinzips "Film" mit ständigen Brüchen zwischen Fiktion und Wirklichkeit, die sich nicht nur auf dazwischen eingestreute, anscheinend echte Straßenumfragen mit real people beschränkt, sondern immer wieder auch den Prozess des Filmens und der Aufnahme ausstellt und die Figuren damit in einer Doppelbödigkeit als Charakter wie als Person dahinter zeigt.
Regisseur und Radikalinski Vilgot Sjöman darf man also gern als schwedische Entsprechung von Jean-Luc Godard sehen, allerdings fehlt Sjöman sowohl das Spielerische, das Godard in jenen Jahren immer noch auszeichnete (siehe den zwei Jahre älteren "Masculin, Feminin - die Kinder von Marx & Coca Cola" beispielsweise) und dessen Göttertalent für Bildkompositionen.

14. Leichen pflastern seinen Weg
Ungewöhnlicher Western, übrigens viel weniger exploitativ als der deutsche Titel "Leichen pflastern seinen Weg" glauben lässt - der Originaltitel "The Great Silence" trifft den Kern des Films bei weitem mehr.
Was ich sehr mochte, war dass Setting in dieser trostlosen Schneelandschaft - allein dadurch gelingt Sergio Corbucci atmosphärisch ein völlig anderer Western.
Aufgrund seines Alters ist "The Great Silence" schon etwas behäbig erzählt, deshalb auch nur 6/10 - aber mit klarer Tendenz nach oben, vor allem weil das Ende wirklich sehr überrascht.
Schön nihilistisch.

15. Planet der Affen
Zwei überraschende Erkenntnisse beim Wiedersehen nach gut 25 Jahren: es dauert erstaunlich lange bis aus der Weltraumexpedition tatsächlich ein "Planet der Affen" wird und die ersten Primaten zu sehen sind. Dagegen ist das Ende fast absurd plötzlich, ich hätte hier einen weit längeren Weg in die "verbotene Zone" erwartet.
Ein wenig angestaubt ist "Planet der Affen" natürlich schon, aber die Grundidee und der letztendliche Twist sind immer noch beeindruckend. Kurios, dass die Wissenschaftsfeindlichket der Affen-Polit-Elite heute noch treffender satirisch wirkt als es damals der Fall gewesen sein dürfte!

16. Don Mariano weiß von nichts
Kühl inszenierter, früher Poliziottesco, dem die effektheischerische Krassheit der späteren Euro Crime - Welle abgeht, sondern mehr als Analyse auf eine durch und durch korrumpierte Gesellschaft zu lesen ist, die auch mit den besten Absichten nicht erlöst werden kann, da die Verstrickungen zu tief sind.
Ein junger, bestechend blauäugiger Franco Nero spielt den idealistischen Polizisten, der sich mit den Gegebenheiten nicht abfinden will und sich zum Gegenspieler des örtlichen Mafia-Bosses aufschwingt (der hier angenehmerweise nicht als idealisierter Mob-Chef gespielt wird, sondern als Eminenz im Hintergrund, die geräuschlos Strippen zieht und auch ohne Brimborium via der Vergabe von Bauvorhaben seine Macht beweist).
So ist "Don Mariano weiß von nichts" ein ungewöhnlicher, realistisch geerdeter Mafia-und-Polizei-Film in der sengenden Sonne Süditaliens, der bis zu seinem Ende konsequent bleibt.

17. Sympathy for the Devil
Godards sehr experimenteller Ausflug ins Studio der Rolling Stones, ausgerechnet an jenem Tag, als die Band "Sympathy For The Devil" zusammen komponierte.
Godard beobachtet die Band mit einer wandernden Kamera, während "Sympathy For The Devil" langsam Gestalt annimmt. Jagger, Richards & Co sind in End60er-Fashion wie Harlekine gekleidet und stehen in den farbenprächtigsten Ecken eines geräumigen Studios in London herum, während Godard mit seiner Kamera durch den Raum läuft.
Call it Entmystifizierung, call it Dokumentation, aber nenn es auf jeden Fall einnehmend und faszinierend.
Dass Godard sich 1968 natürlich nicht mit einer schnöden Studio-Doku zufriedengeben würde, ist eh klar: denn zwischen den Segmenten mit den Stones und dem "...Devil" bringt Godard seine Art von Polit-Propaganda-Sketche, die ohne jeden Zusammenhang gedroppt werden. Da stehen militante Schwarze zwischen ausgebeuteten Autos und deklamieren Slogans, da rennen junge, hübsche Frauen am Strand entlang und werden mit Kunstblut beschmiert, da grüßen Kids im Comicbuchladen Mao während Godards Kamera über Erotikschriften, Graphic Novels und Lifestyle-Magazine fährt.
Selbst für Godard-Verhältnisse sieht "One Plus One" fantastisch aus. Erverweigert sich natürlich jedem Narrativ oder Plot, geht also noch einen Schritt weiter als in "La Chinoise" im Jahr zuvor. Bald wird sich Godard ganz aus der Popkultur verabschieden.
Schade, er hätte im Kampf hier mehr bewirken können als in den kommenden Jahren in jener Ecke, als er nur noch zu den eh schon Bekehrten predigte.

18. Die Braut trug schwarz
Auf den Kirchentreppen, am Tag der Hochzeit, wird der Ehemann erschossen. Die überlebende Braut widmet den Rest ihres Lebens der Rache und der Suche nach den Tätern.
Kommt bekannt vor? Yepp, "Die Braut trug schwarz" von Truffaut ist praktisch der Plot-Blueprint zu Tarantinos "Kill Bill".
So lange Truffaut die Tat im Ungefähren lässt und uns nur bruchstückhaft mit Informationen versorgt, warum diese Frau all diese Männer tötet, fasziniert mich "Die Braut trug schwarz" ziemlich. Doch mit der Beleuchtung der banalen Hintergründe - ungefähr mittig im Film - verliert Truffauts "Braut" stark an Verve und gewinnt erst durch sein zunächst rätselhaftes, dann ziemlich smart-gemeines Ende wieder.
Insgesamt nicht nur filmhistorisch für Tarantino-Buffs sehenswert, sondern für mich schon einer der besseren Truffaut-Filme.

19. Das Mädchen
Das Balzverhalten junger Ungarn in den ausgehenden 60ern, erzählt aus der Perspektive eines Mädels aus einem staatlichen Waisenhaus.
Insbesondere diese rein weibliche Sichtweise macht "Das Mädchen", den ersten ungarischen Film, der von einer Frau (Márta Mészáros) gedreht wurde, sehenswert: Kati Kovacs signalisiert bereits mit ihrer schicken Kurzhaarfrisur ein Verhalten, das sich von den Konventionen der Gesellschaft lösen will und küsst mal den und knutscht mal jenen.
Besonders deutlich wird bei einem Ausflug aufs ungarische Land im Versuch ihre Eltern zu finden der Gegensatz eines progressiven Budapester Mädchens zu den althergebrachten Einstellungen der Gesellschaft
Allerdings kann ich mit diesem roten Faden der Handlung - Suche nach den Eltern - am wenigsten anfangen, wodurch "Das Mädchen" schon mehr durch seine Impressionen in Beat-Kneipen besticht statt als existentialistische Suche nach der eigenen Herkunft.

20. Funny Girl
Dafür, dass ich bekanntermaßen Musicals hasse, hat mir "Funny Girl" erstaunlich gut gefallen. Was natürlich auch bedeutet: es gibt hier einen richtigen Plot und Menschen reden auch mal statt ständig nur zu singen. Die Musikeinlagen sind auch meist in die Handlung schlüssig eingebunden und fallen nicht vom Himmel.
Herzstück von "Funny Girl" ist eine toxische Beziehung zwischen Omar Sharif (toll!) und Barbra Streisand (straight aus der Otto-Waalkes-Overacting-Schule) mit langem sie-kriegen-sich-sie-kriegen-sich-nicht-Beginn. Die dann doch folgende Beziehung wird in der zweiten Film-Hälfte durchaus düster. Dank des Charmes von Omar Sharif ist die rechte Arschlochhaftigkeit seiner Figur gerade noch akzeptabel, allerdings auch fraglos ein Produkt ihrer Zeit.
Streisand hat trotz ihres Overactings eine solche Frische, dass ich erstmals verstanden habe, warum sie so ein Weltstar geworden ist. Dass bei acht Oscar-Nominierungen als einziger Gewinn die Auszeichnung für die beste Hauptrolle für Streisand herausgesprungen ist, ist natürlich trotzdem not funny.

21. Dom kallar oss Mods
"Then I started to run around with the Mods and I don't regret that 'cause I never had so much fun as last year."
If Beavis & Butthead were real. Und schwedische Paisley-Mods.
Fly On The Wall Dokumentation aus dem schwedischen Untergrund der ausgehenden 60er. Die beiden Protagonisten Kenta & Stoffe hätte man ein Jahrzehnt vorher wohl "Halbstarke" genannt, ein Jahrzehnt später Punks.
Individuen, deren Lebenswege so komplex und kaputt sind, dass sie schon als späte Teens selbst in eine so liberale Gesellschaft wie die schwedische nicht mehr passen mögen.
"Dom kallar oss Mods" (oder auf englisch: "They call us Misfits") zeichnet ein Jahr im Leben der beiden Rowdys nach, handelt von Spaß, Saufen, Sex, Drogen, unter Brücken schlafen und ist offensichtlich ungeskripted, was aber auch einigen Leerlauf mit sich bringt.
Stefan Jarl verfolgte mit zwei weiteren Dokumentationen den Lebenslauf von Kenta und Stoffe in späteren Jahrzehnten und hat damit ein Pendant zur berühmten "UP!"-Dokuserie geschaffen, nur dass Jarl an die Ränder der Gesellschaft blickt und nicht mehr wegschaut.

22. In the Year of the Pig
"Only God is objective, and he doesn’t make films.”
"In The Year Of The Pig" ist eine Dokumentation über den Vietnamkrieg, die im Moment seines Wütens entstanden und damit bemerkenswert hellsichtig ist.
Im Gegensatz zu vielen anderen Kriegsdokumentationen schaut "In The Year Of The Pig" nicht unbedingt auf die Schlachtfelder, sondern in die Hinterzimmer der Macht. Der Fokus liegt auf dem Warum des Krieges, das die Felder erst zu Schlachten werden ließ und ist dabei enorm aufschlußreich. Dass der Vietnamkrieg zum Zeitpunkt dieser Dokumentation noch Jahre dauern würde, ist leider in den Interviews und Mitschnitten von Politikerreden bereits absehbar, denn die US-Politik kann sich eine Niederlage einfach nicht vorstellen (bis sie gut sieben Jahre tatsächlich eintreten wird).
Regisseur Emile de Antonio kommentiert nicht aus dem Off, sondern reiht (westliche) Aussage an Aussage und trifft dennoch in seiner Montage natürlich ein Statement zum Krieg. Dass er auf der Seite von Ho Chi Minh steht, ist kaum verklausuliert. Daraufhin kritisiert, antwortete er mit dem schönen Satz: "Only God is objective, and he doesn’t make films".
P.S.: Das Cover des The Smiths - Albums "Meat Is Murder" ist aus dieser Doku, die originale Helmbeschriftung "Make War Not Love" wurde in den Albumtitel abgewandelt.

23. Dom kallar oss Mods
"Then I started to run around with the Mods and I don't regret that 'cause I never had so much fun as last year."
If Beavis & Butthead were real. Und schwedische Paisley-Mods.
Fly On The Wall Dokumentation aus dem schwedischen Untergrund der ausgehenden 60er. Die beiden Protagonisten Kenta & Stoffe hätte man ein Jahrzehnt vorher wohl "Halbstarke" genannt, ein Jahrzehnt später Punks.
Individuen, deren Lebenswege so komplex und kaputt sind, dass sie schon als späte Teens selbst in eine so liberale Gesellschaft wie die schwedische nicht mehr passen mögen.
"Dom kallar oss Mods" (oder auf englisch: "They call us Misfits") zeichnet ein Jahr im Leben der beiden Rowdys nach, handelt von Spaß, Saufen, Sex, Drogen, unter Brücken schlafen und ist offensichtlich ungeskripted, was aber auch einigen Leerlauf mit sich bringt.
Stefan Jarl verfolgte mit zwei weiteren Dokumentationen den Lebenslauf von Kenta und Stoffe in späteren Jahrzehnten und hat damit ein Pendant zur berühmten "UP!"-Dokuserie geschaffen, nur dass Jarl an die Ränder der Gesellschaft blickt und nicht mehr wegschaut.

24. Elvis Presley's '68 Comeback Special
Nachdem Elvis geschlagene sieben Jahre nicht mehr live aufgetreten war, weil Manager Colonel Parker lieber die Seele des Kings an mediokre Hollywood-Strefen verhökerte, war das "68 Comeback Special" (was erst ein später sich dafür etablierender Name war, da Elvis das Wort "Comeback" gar nicht mochte und ursprünglich die Sendung schlicht eine Weihnachtssendung werden sollte) für ihn die Möglichkeit, sich gegenüber Parker zu emanzipieren und zu zeigen, dass er noch eine Relevanz in der sich wildüberschlagenden musikalischen Szene der Mitt/End-60er hatte.
Das "Comeback Special" hat immer dann seine allerbesten Momente, wenn Elvis in einem intimen Setting, auf einer minimalistischen Bühne inmitten einer handvoll Zuschauer einfach mit Gitarre seiner Songs performed (ein Setting, das sich übrigens die Strokes für ihr legendäres 2$-Bill-Konzert 2002 ausgeliehen hatten*). Die Schwächen sind dagegen in den großen "Musical"-Nummern zu finden, die heute nicht nur albern wirken, sondern eben auch überproduziert sind im Vergleich zu den wunderbar reduzierten Rocknroll/Blues/Gospel-Liedern, die Elvis inmitten der Zuschauer spielt.
Ausnahme hiervon ist natürlich der Schlußsong "If I Can Dream" (für mich der 36.beste Song des Jahres '68 überhaupt), den Presley in weißem Anzug vor dem ikonischen, roten ELVIS-Schrift-Backdrop als Rauswerfer anstelle des ursprünglich hier eingeplanten Weihnachtslieds performed.
* https://www.youtube.com/watch?v=dqOIonni7-Q

25. Live a Little, Love a Little
Ein herrlicher Quatschfilm mit Elvis. Völlig durchgeknallte Geschichte um einen Fotografen (Elvis), der zwei Jobs im gleichen Haus ausführt - für ein Nacktmodelmagazin sowie für eine sehr konservative Agentur. Was folgt? Verwirrung galore!
"Live a Little, Love a Little" ist allein schon deshalb unvergesslich wegen all den Szenen, in denen Elvis mit einer deutschen Dogge an einem Tisch sitzt.
Popkulturell hatte dieses Elvis-Vehikel unerwartete späte Nachwirkungen, ist doch die Originalversion von "A Little Less Conversation" aus diesem Film und wird auch von Elvis in einer sehr psychedelisch-schwingenden Szene dargeboten. Ein "Edit"/Remix dieses Rocknroll-Knallers durch Junkie XL war Anfang der 2000er ein Nummer-1-Hit in UK sowie in den deutschen Top 10.

26. Death by Hanging
Der japanische Film "Death By Hanging" ist zugleich ein zutiefst politischer Film wie ein absurdistisches Spektakel. Nagisa Ôshima beginnt mit einem dokumentarischen Monolog über Zustand und Durchführung der Todesstrafe in Japan. Doch als er exemplarisch in einem theaterhaften Setting eine Hinrichtung vorführt, stirbt der Hingerichtete, ein junger, der Vergewaltigung und des Mordes angeklagter Koreaner, nicht.
In der Folge versuchen die anwesenden Eminenzen, die wie in Pasolinis "Salo" exemplarisch als Symbole für verschiedene Ausprägungen des Establishments stehen (Judikative, Exekutive, Kirche...), den nicht-toten Hingerichteten zu einem neuerlichen Geständnis und erneut zu einer Exekution zu bewegen.
"Death By Hanging" ist ob der Absurdität nach seinem ersten Drittel ein wirklich schwer greifbarer Film, der es weder sich noch dem Zuschauer leicht macht - aber am Ende ein unmissverständliches, humanistisches Pladoyer gegen Hinrichtungen formuliert.

27. Black Panthers
Mehr Momentaufnahme als Dokumentation:
ein Blick von Agnes Varda auf die Proteste gegen die Verhaftung von Black Panther - Führer Huey P. Newton, viele O-Töne der Demonstrierenden (und von einem älteren weißen Herrn aus Texas) inklusive.
Die Bilder versprühen bestes grobkörniges End60ies-Flair, der Rebel Chic der Black Panthers fasziniert noch immer und die spontanen Gesangseinlagen vor dem Justizgebäude wären hervorragende Samples für das nächste Sault-Album.
Sieht man die Bilder der Black Panther in ihrer utopistisch-individuell-militaristischen Kleidung und hört die Thesen, die von Antirassismus zu Marxismus reichen, weiß man sofort, warum das weiße, konservative, kapitalistische Amerika so vor ihrer Wirkung gezittert hat!

28. The Perfect Human
2003 brachte Lars von Trier "Five Obstructions" ins Kino. Gegenstand dieses Dokumentarfilms war ein Spiel mit der dänischen Regielegende Jorgen Leth, der 1968 den Kurzfilm "The Perfect Human" gedreht hatte.
Von Trier forderte Leth auf, seinen eigenen Film mehrfach neu zu inszenieren, aber immer nach einschränkenden vontrier'schen Vorgaben. Ergebnis war ein unterhaltsamer, sehr lehrreicher und sich manchmal etwas sadistisch anfühlender Film, der damals natürlich mein Interesse an der Vorlage geweckt hatte.
Nur 19 Jahre später bin ich nun auch dazu gekommen, "The Perfect Human" zu sehen. Leths 'perfekter Mensch' ist minimalistisch, aber sehr schön gefilmt - auf blendend weißem Backdrop tanzt, isst und räkelt sich der perfekte Mensch, die reine Oberfläche, die pure Projektion.
"Today I experienced something I hope to understand in a few days".

29. Gefahr: Diabolik!
Gar nicht so trashig wie erwartet. Gut gefilmt von Mario Bava in beeindruckendem Farben-Overkill, aber natürlich ein wirres Drehbuch.

30. Nackt unter Leder
In den 60ern nannte man das Spielfilm:
Marianne Faithfull fährt - "nackt unter Leder" - auf einem Motorrad vom Ehemann im Elsass zum Liebhaber nach Heidelberg (Alain Delon), tagträumt und philosophiert dabei über freie Liebe, Wollust und gesellschaftliche Konventionen.
Schöne Bilder und viel swinging psychedelic feeling, aber für die Verhandlung von selbstgewählten (Ohn-)Machtspositionen in Mann/Frau-Beziehungen ist Bunuels "Belle De Jour" sicher der schlauere Film.
Kommentare
Noch keine Kommentare vorhanden.Als Mitglied der motorjugend mit dem Rang Blicker oder mehr kannst Du an dieser Stelle einen Kommentar zu dieser Version abgeben und andere Kommentare kommentieren.